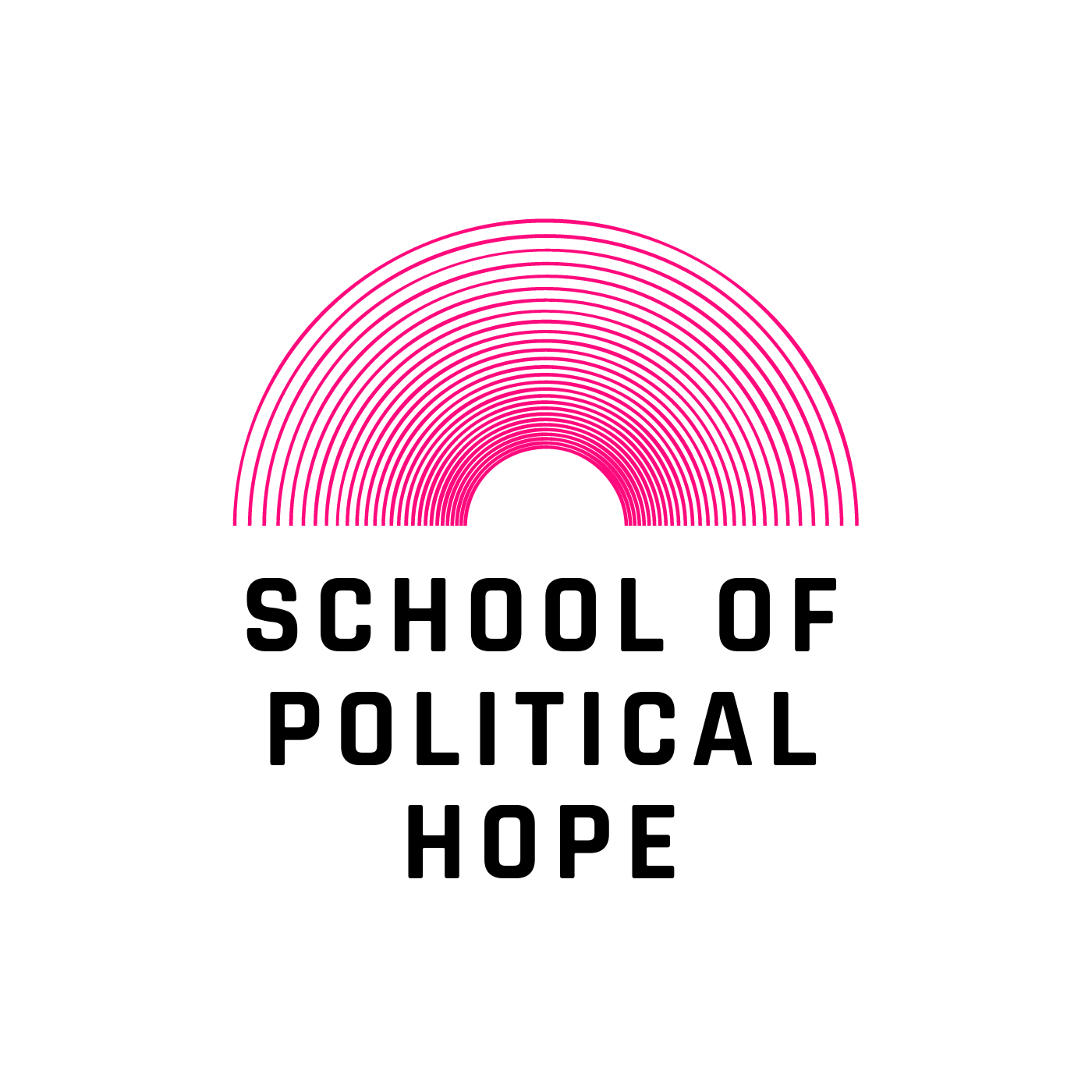Eröffnungsrede von Georg Blokus zur Gruppenausstellung »Auf_begehren | on_desire«
Für eine Poesie aus der Zukunft oder: Eine Kunst der Revolte
Für Studierende und Alumni der Klasse Raumkonzepte (Candice Breitz & Eli Cortinas) der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
29. November 2019, Galerie vom Zufall und vom Glück, Hannover
Liebe Freundinnen und Freunde,
»Are you sure, you are inside«, hat Ivana Rohr, die einzige Künstlerin im Raum, die ich zumindest flüchtig kenne, an die Fensterscheibe am Eingang der Galerie in großen Buchstaben geklebt. Wenn ich selbst eine Antwort geben müsste, würde ich sagen: Ich bin mir nicht sicher.
Ich muss ehrlich zugeben, dass auch 12 Jahre, nachdem ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Kunstgalerie betreten habe, diese künstlerischen, ja, nicht selten auch künstlichen und gekünstelten Räume immer noch ihre befremdliche und befremdende Wirkung auf mich nicht verloren haben.
Und doch wissen alle, die mich kennen, dass und wie sehr ich für das Vertrauen dankbar bin, heute hier von den Studierenden der Klasse Raumkonzepte von Candice Breitz und Eli Cortinas eingeladen worden zu sein, um meine Positionen aus dem Blickwinkel der Künste und des Aktivismus auf die aktuellen globalen Wirklichkeiten – ich würde lieber auf die ‘planetare Realität’ sagen – mit den Arbeiten der Gruppenausstellung »Auf_begehren | on_desire« in ein Gespräch zu bringen.
Ich freue mich umso mehr, weil ich den meisten von Ihnen selbst fremd und nicht bekannt sein werde. Trotz regelmäßigen Google-Suchen nach mir selbst ist auch mir bis heute nicht bekannt, dass ich bislang etwas Künstlerisches oder Aktivistisches geschaffen hätte, dem größere Bedeutung zugeschrieben worden wäre. Und auch mein Alter von 32 Jahren bedeutet in der zeitgenössischen Kunstwelt, in der Stipendien für Nachwuchskünstler*innen bis 45 vergeben werden, lediglich, dass ich – wie die meisten von Ihnen und euch auch – täglich darum bemüht bin, irgendwo zwischen Selbstausbeutung und Widerstand meine Existenz zu behaupten. Umso schöner, wenn man dann als Fremder und Unbekannter seine Gedanken und Gefühle zum aktuellen Zustand des Planeten teilen darf.
Zu Beginn sehe ich mich deshalb aber gezwungen, mich vorzustellen und einige Worte zu meiner Person, meinem Werdegang und vor allem meiner Position zwischen Kunst und Aktivismus zu verlieren. Bitte verstehen Sie dies nicht als obszöne Geste der Selbstvermarktung! Es geht mir lediglich darum, mich und meine Gedanken verständlicher zu machen bzw. nicht in eine – womöglich selbstgestellte – narzisstische Falle zu tappen, vermeintlich interessanter oder geistreicher wirken zu wollen, als ich es eigentlich bin.
Ich sage das nur, weil ich hier ja in einem Kunstraum spreche, und in solchen Räumen ja bekanntlich häufig die Regel gilt, dass alles umso ‘interessanter’ und ‘spannender’ wirkt, je unverständlicher und unzugänglicher es ist. Eine kurze Randnotiz: Weil ich selbst immer noch vieles, was mir in der Kunstwelt begegnet, nicht nachvollziehen kann und häufig auch nach längerem Nachsinnen keine sinnvollen Einsichten finde, habe ich mir, wenn ich mit Studierenden zusammenarbeite, die Regel gesetzt, die Nutzung der Begriffe ‘interessant’ und ‘spannend’ zu verbieten, wenn verlangt ist, die Wirkungen von Kunst zu beschreiben.
Zunächst aber nur so viel zur Macht und Ohnmacht, aus denen die teilweise luftleeren Räume der Kunstwelt so bestehen. Ich stehe heute nicht hier, um noch mehr Macht und Ohnmacht zu verbreiten. Ich will vielmehr versuchen, einen kleinen, mir möglichen Beitrag dazu zu leisten, was die US-amerikanische Feministin und Historikerin Donna Haraway »change the deadly story« genannt hat. Ein Denken versuchen, das nicht in der ewigen Wiederholung der immergleichen schönen, kritischen Worte und Analysen verharrt und so unsere politische Paralyse nur stärker werden lässt. Sondern vielmehr ein Denken wagen, das sich als Erzählen von Geschichten und Geschichte, einen Weg in die ‘verlorene Zukunft’ bahnt. Ich persönlich erinnere mich, dass ich erst mit 15 Jahren zum ersten Mal freiwillig ein Buch gelesen habe und eine erste Ahnung davon bekommen habe, welche Macht Geschichten und Geschichte haben.
1990, vor fast 30 Jahren, bin ich mit meinen Eltern aus der Nähe von Danzig in Polen ins Rheinland gekommen. Meine Eltern erzählten mir kürzlich, dass sie in Polen gerne in die Oper gegangen seien. In Deutschland waren sie bis heute meines Wissens nach nicht ein einziges Mal in der Oper, geschweige denn in Kunstgalerien. Nachdem der sog. ‘realexistierende Sozialismus’, der in etwa so wenig mit Sozialismus zu tun hatte wie der Markt mit Freiheit oder Kapitalismus mit Demokratie, eher zu spät als zu früh sein Ende gefunden hat, der ‘Ostblock’ einem radikalen ‘neoliberalen Experiment’ unterzogen wurde und meine Eltern sich in Deutschland zwischen schlecht bezahlter männlicher Lohnarbeit, institutionellem Rassismus im Sozialamt, den mütterlichen Nöten der Erziehungsarbeit und den drei Artikeln der deutsche Sprache durchkämpften, waren die Kunst und die Kultur in meiner Familie wie ‘aus der Welt’.
Erst verhältnismäßig spät hatte ich das zufällige Glück, erste Zufluchtsorte gezeigt zu bekommen – für mein bis dahin unaussprechbares Empfinden, dass irgendwas mit mir, meiner Familie, diesem Land und/oder der Welt nicht stimmen könne. Es waren leidenschaftliche und liebevolle Lehrer*innen, die einem den Glauben und die Freude schenkten, von denen man damals selbst noch nichts ahnen konnte – dass es Räume wie das Theater gibt, an denen man das Unaussprechliche verstehen lernen und durch die Aneignung der Macht der Bilder und Worte vielleicht sogar die Bühne der Welt verändern kann. Wir können diesen Menschen, die uns diese Wege aufgezeigt haben, im Nachhinein nicht dankbar genug sein.
Nach der Schule hatte ich dann Angst vor Kunst- oder Theaterhochschulen, auch wenn ich heute manchmal bereue, diesen Weg nicht eingeschlagen zu haben. Die klischeehafte Vorstellung von den Menschen, den Strukturen und den Initiationsritualen in diesen Gebäuden lähmte mich so sehr, dass ich zu dem Schluss kam, dass nur ein Studium der Psychologie mein Leiden lindern könnte. Ja, ich habe mehr über das Menschliche und Allzumenschliche lernen wollen, um mir selbst zu helfen. Dass ein Studium heutzutage aber selbst eine leidsame Erfahrung sein kann, wurde mir schon nach wenigen Wochen bewusst. Um nicht in eine tiefe Depression zu verfallen, entschied ich mich mit einigen guten Freunden, die Verantwortung für das Schultheaterprojekt zu übernehmen, das zuvor noch von einem meiner ehemaligen Lehrer geleitet wurde, der kurz zuvor aber leider viel zu früh verstorben war. Ohne jegliche professionelle Rechtfertigung und mit spärlichem künstlerischen und pägagogischen Wissen ausgestattet kämpften wir uns mutig und vor allem naiv durch die ‘Spielregeln’ des Theaters, der Inszenierung, der Dramaturgie, der Schauspielerei und nicht zuletzt der politischen und ästhetischen Fragen, die sich uns stellten.
Mit der Zeit stellte sich für mich mehr und mehr heraus, dass dort, wo ich stehe, Dokumentartheater, politische Kunst und Aktivismus aufeinander treffen. Die Erfahrung der ästhetischen Ohnmacht gegen die politische Macht wurde mit den Jahren jedoch nicht schwächer, sondern eher stärker. Wie soll man denn nur mit den symbolischen Mitteln der Kunst eine Welt verändern, in der die Politik selbst nur noch symbolisch ist? Und wie soll man in, durch und mit der Kunst etwas ‘Reales’ schaffen, wenn doch die Kunstwelt selbst so irreal ist und alles Reale in ihren Schlund zieht?
Ich hatte ein weiteres zufälliges Glück, als ein Freund, der leider auch viel zu früh verstorben ist, mich fragte, ob ich nicht in Köln für die Akademie der Künste der Welt die Leitung des Nachwuchskünstler*innenprogramms übernehmen wolle. Auch wenn ich mich ehrlich fragte, was ein Nachwuchskünstler selbst da genau leisten können sollte, sagte ich natürlich zu. Zum ersten Mal mit Kunst Geld zu verdienen – wenn auch schlechtes – und vor allem die Einsicht, nun für das Lernen durch Lehren bezahlt zu werden, schienen mir überzeugend genug.
Auch wenn ich noch heute behaupte, dass ich Kunst nie gelernt habe und eigentlich nach einem leidsamen Studienweg nur Diplom-Psychologe bin, behaupte ich zugleich als Theatermacher, Aktionskünstler und politischer Aktivist oder Kulturorganizer tätig zu sein. Der Ort, wo ich heute verweile, nennt sich »School of Political Hope«, eine transeuropäische politisch-künstlerische Organisation mit Sitz in Köln, die 2017 von mir und anderen befreundeten politischen Künstler*innen und Aktivist*innen gegründet wurde. Dort versuchen wir die Mittel der politischen Kunst, des Aktivismus und der Bildung miteinander zu verbinden, ihre Grenzen immer wieder zu überwinden, indem wir lokale und transnationale Langzeitprojekte initiieren und unterstützen – mit und von all jenen politischen Menschen und Bewegungen, die schon heute in der ‘Jetztzeit’ mit allen damit einhergehenden Entbehrungen politische Hoffnung für uns alle tragen – dass die Welt nämlich doch veränderbar ist.
Die ‘Schule’ ist damals aus diesem quälenden Gefühl entstanden, als wir wortreich und doch sprach- und bewegungslos vor den Theatern, den Kunstgalerien und den linken Zentren standen und uns fragten, ob es nicht doch Wege geben könnte, diese politische Ohnmacht, die wohl die meisten von uns hier teilen, zu überwinden. In gewisser Weise war es ein unangenehmes Gefühl der Enttäuschung von den gegebenen Institutionen und dem, was sie von der Welt da draußen repräsentieren. Und vor allem aber auch eine Desillusionierung darüber, wie sie nicht imstande sind, aus dem Teufelskreis des kritischen Diskurses in so etwas wie ‘konstruktiv ungehorsame’ Aktion zu kommen.
So machten und machen wir uns heute immer noch – bislang weniger erfolgreich – auf den ‘langen Marsch durch die Institutionen’, auf der Suche nach Fördergeldern und Anerkennung, um selbst so etwas wie eine ‘Institution’ zu werden. Aber eine bewegte Institution oder auch eine Institution in Bewegung, die Gemeinschaften von ‘Wiren’, unterschiedliche Stimmen in einem gesellschaftlichen, transeuropäischen und vielleicht auch planetaren Chor der Vielen vereint, versammelt und aufbaut. Um dem zynischen Zeitgeist, dass in dieser Welt nichts Gutes, Schönes und Wahres mehr geschaffen werden könnte, etwas konkret Hoffnungsvolles, ja, reales Anderes entgegenzusetzen.
Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mit einer Freundin geschrieben, die Sängerin ist und mir freundlicherweise erlaubt hat, hier heute von unserer letzten Konversation zu sprechen. Sie schrieb mir, dass sie an diesem Tag vor einem staatstragenden Publikum zu Ehren des verstorbenen Zwillingsbruders des polnischen Schattendiktators Jaroslaw Kaczynski gesungen hatte. Ich meinte auf diese ‘frohe Botschaft’ hin nur, dass jede*r Künstler*in entscheiden müsse, auf welcher Seite er*sie steht und für wen und wofür er*sie ihre Kunst macht. Ihre leicht provokante Antwort lautete: »Aber ich bleibe neutral. Meine Stimme dient den Reichen und den Armen, den Linken und den Rechten, allen … :-)«. »Bitte nicht!«, tippte ich nur flapsig ins Smartphone zurück. Ihre Antwort kam noch schneller, aber auch überraschender bei mir an: »Das ist ein Witz, oder?«
Nein, es war natürlich kein Witz von mir, wie Sie sich wahrscheinlich schon denken können. Ich solle wissen, dass meine Sicht »eine etwas Eingeschränkte« sei, wenn ich »die Welt nur durch die Spaltung in Links und Rechts, Arm und Reich, Opfer und Täter, und wie Dinge sind und nicht wie sie sein sollten …« sähe. Was sie wohl nicht ahnte und auch mir erst später bewusst wurde, war, dass ich mich von ihrer nicht böse gemeinten Position ernsthaft getroffen fühlte.
Nicht, dass ich notgedrungen immer auf der richtige Seite stehen, geschweige denn immer richtig liegen würde. Warum aber fühlte sie sich durch meine Aussage angegriffen, nicht ernst genommen und als »dumme Künstlerin« dargestellt, wie sie schrieb? Wenn ich doch nur mit ihr nicht übereinstimmte und meine Überzeugung kundtat. Und warum zog sie zugleich ein spürbares Vergnügen aus den Erfolgen, sich nicht von mir und einem – wie sie es nannte – »unsichtbaren Netzwerk von linken Menschen für ihre Sache rekrutieren« zu lassen?
Sie konnte nicht geahnt haben, dass ihre Worte in mir stärker nachwirken würden, da ich gerade in den letzten Monaten immer wieder eine nicht klar benennbare Form von ‘politischer Einsamkeit’ verspüre und mit Sorge erfüllt werde, wenn mir nahestehende Freund*innen und befreundete Künstler*innen ‘uns’, die wir mehr oder weniger unbeholfen versuchen, etwas gegen den Wahnsinn da draußen zu tun, nur lächelnd zuwinken. Äußerst selten als freundschaftliche Geste der politischen Annäherung, viel häufiger als leicht herablassende Geste der politischen Entfernung. Auch wenn es häufig anders lautet, ich befürchte zunehmend, dass der Hashtag #wirsindmehr nicht hinreichend der Realität in diesem Land gerecht wird. Denn wie meine gute Freundin schon sagte, die Welt ist vielschichtiger als die Unterscheidung in Links und Rechts. Und es ist unklar, ob die sog. ‘Mitte’ wirklich unseren Träumereien und mehr oder weniger konkreten Plänen von der Zukunft Glauben und Vertrauen schenken wird.
Ob ‘wir’ wollen oder nicht, ob selbstverschuldet oder unschuldig schuldig geworden: Wenn wir ‘Linken’, ‘Progressiven’, ‘Linksliberalen’ oder wie auch immer wir uns schimpfen unsere Sicht der Dinge kundtun, müssen wir heute leider damit leben, dass wir uns offensichtlich in eine Traditionsgemeinschaft der intellektuellen Arroganz einordnen, die im Verlauf der letzten Jahrzehnte nicht ohne unser Zutun – oder eher das unserer Vorgänger*innen – zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung geworden ist. Wer heute für eine Welt kämpft, wo ein Leben in Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit für alle – ohne Ausnahme! – möglich sein soll, macht sich notgedrungen der akademischen Ignoranz, der moralischen Überheblichkeit oder der subkulturellen Bedeutungslosigkeit schuldig.
Der französische Philosoph und Soziologe Geoffroy de Lagasnerie meinte dazu kürzlich in einem Interview, dass heute »eine völlige Entkopplung zwischen der Sprache der Politik und den Erfahrungen der Bevölkerung« bestehe. Für die Kunst kann man meiner Ansicht nach das gleiche konstatieren. Die Tragik an der ganzen Angelegenheit bestehe wiederum darin, dass die sog. ‘Linke’ seit 30 Jahren den Wettbewerb um die abstrakteste und unverständlichste Sprache mit weitem Vorsprung vor allen anderen gewonnen hat. Nein, Migrant*innen, alleinerziehende Frauen, Schwarze Menschen, Arbeiter*innen und viele mehr finden ihre ungehörten Stimmen, ihre Erfahrungen des harten Alltags, ihre politischen Gefühle und Leidensgeschichten heute nicht notgedrungen in den schönen, kritischen Reden der ‘Linken’ wieder – und genauso wenig in den kritischen Publikationen, Festivals und Konferenzen der Künstler*innen, Theoretiker*innen und Kritiker*innen.
Und doch wirke es nach de Lagasnerie heute so, als ob »das Verdrängte des Systems wiedergekehrt« sei, die gesamte Brutalität der sozialen und ökonomischen Gewalterfahrungen kehrt schließlich in den medialen Bildern vom Widerstand der Revoltierenden und der hässlichen Staatsgewalt gegen die Proteste in Chile, in Hongkong, im Libanon und an vielen anderen Orten wieder ins Bewusstsein, in die Körper, ‘in die Zeit zurück’.
Es ist so etwas wie ein globales ‘Aufbegehren’ im Entstehen – um den Titel der Ausstellung aufzugreifen. Ein Aufbegehren, dass trotz unterschiedlicher lokaler Realitäten, Sprachen, Kulturen und Leiden eine planetare Gemeinschaft von ‘Wiren’ – auch der Tiere, der Natur und der Dinge – spürbar macht, die in der Einsicht der geteilten Unfreiheit vereint sind. So erscheinen heute erste, zuvor noch vereiste Fußspuren auf den Trampelpfaden der Geschichte, die uns in die Fußstapfen der lange im historischen Nichts verschwundenen Freiheits- und Gerechtigkeitskämpfer*innen vergangener Tage treten lassen.
Möglicherweise ist es das, was eine der Künstlerinnen in dieser Ausstellung, im Sinn hatte, als sie in der Ankündigung zu dieser Ausstellung schrieb:
»Vielleicht ist es kein Zufall und vielleicht hat es auch mit Glück nichts zu tun, dass wir heute hier sind, heute im Jetzt, und auf_begehren. Dass wir auf Begehren sind, so wie im Rausch, on_desire. Es drängt.«
— Marie Dann
Der kroatische Philsoph und politische Aktivist Srecko Horvat hat dieses Phänomen in seinem neuen Buch als »Poetry from the Future« bezeichnet, den Moment, in dem die Geschichte aus der Zukunft in uns hinein drängt und uns nach vorne treibt.
Als ich heute Mittag im Zug von Köln nach Hannover saß und versuchte, diese Eröffnungsrede zu schreiben, habe ich da draußen in mehreren Städten Menschen vorbeiziehen sehen, die am heutigen 4. Globalen Aktionstag für Klimagerechtigkeit protestiert haben. Im gleichen Moment lief auf meinem Laptop das Facebook-Video von einem kleinen Mädchen aus Chile, die mit noch mittelmäßiger Textsicherheit, aber dafür umso größerer Leidenschaft und vollem Körpereinsatz zum Orchester tanzte, das hinter ihr auf dem Platz die chilenische Protesthymne »El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido« spielte. Es ist genau dieses Bild, das die ‘Poesie aus der Zukunft’ symbolisiert, wie sie hier in unser aller noch gelähmten Körpern heute noch schläft, um aber schon morgen wieder zum Leben erweckt zu werden.

Als kürzlich in Santiago de Chile auf der Wand eines Hochhauses eine Lichtprojektion mit der Aufschrift »Wir werden nicht zur Normalität zurückkehren, denn die Normalität war das Problem« erschien, war dies für mich einer der hoffnungsvollsten Momente der letzten Jahre. Denn hier wurde zum Ausdruck gebracht, dass unser Begehren anfängt, Abschied zu nehmen von der Welt, wie wir sie kennen und erleiden, und wir wieder bereit werden, nach Neuem zu begehren. Was wenn Chile, das Land, in dem der sog. ‘Neoliberalismus’ seinen Anfang genommen hat, auch der Ort sein wird, an dem sein globales Ende eingeläutet wird und wir und vor allem die vielen Aufbegehrenden da draußen in der Welt vielleicht doch den Glauben daran zurückgewinnen, dass es ein Leben vor dem Tod gibt? Ohne diesen politischen Weltschmerz, der uns die Freude am Leben und Arbeiten nimmt.
Aber es wird auch hier für uns im ‘Globalen Norden’ Zeit, die politische Prokrastination zu überwinden, und nicht weiter dem Glauben anheim zu fallen, dass wir ja nichts tun könnten, weil es uns ja verhältnismäßig besser gehe. Was aber, wenn die Probleme der Anderen nur lösbar sind, wenn wir unsere eigenen ernst nehmen? Und was, wenn die Probleme am anderen Ende der Welt nur weiter bestehen, weil wir es nicht tun?
Der Literaturwissenschaftler Frederic Jameson sagte einst: »Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus.« Der britische Philosoph Mark Fisher, der sich 2017 leider das Leben genommen hat, hat diese politische Analyse dann unter dem Begriff »Capitalist Realism« auf die Ästhetik, die Popkultur und die Kunst übertragen. Auch hier erscheine es uns leichter, nach den eskapistischen oder den apokalyptischen Phantasien zu streben, in denen sich das Leid und die Kritik in den immergleichen, dagewesenen Formen im Sinne eines ‘Rette sich wer kann’ reproduzierten, als aus der vermeintlichen Alternativlosigkeit auszubrechen und eine neue politische ‘Poesie aus der Zukunft’ oder eine ‘Kunst der Revolte’ zu wagen, wie es Geoffroy de Lagasnerie nennt.
Ich habe kürzlich in einem transnationalen Theaterprojekt mit 150 Jugendlichen aus sechs unterschiedlichen europäischen Ländern, die über eine Woche zusammen gelebt und gearbeitet haben, einen Jugendlichen gefragt, der vor wenigen Jahren aus Syrien ins Ruhrgebiet geflohen ist, wie es für ihn sei, nun an diesem Ort zu sein, an dem nur die Regeln der Kunst galten. Er antwortete: »Ich könnte hier sterben.« Diese Antwort berührte mich, weil sie doch den Kern dessen traf, was ein Leben in Solidarität ist – Orte und Beziehungen in der Welt zu schaffen, an denen Menschen einfach keine Angst haben brauchen, zu sterben. Und noch mehr: Orte und Beziehungen zu schaffen, in denen das Leben es wert ist, gelebt zu werden. Was könnte dies besser leisten als die Kunst?
Ich möchte mir deshalb, bevor ich schon bald abschließe, noch kurz erlauben, ein wenig Pathos gegen unsere hochkultivierte, abgeklärte ‘Coolness’ in Stellung zu bringen: Es wird langsam Zeit, dass wir den ‘Weltraum’ da draußen so ernst wie den Kunstraum hier drinnen nehmen. Und hinausgehen und unsere friedlichen Waffen der Kunst in den Dienst einer kommenden, planetaren Gesellschaft stellen, um das scheinbar Unvermeidliche, Tragische, Katastrophale … durch das komische, unvorhergesehene Potenzial der menschlichen Kreationen zu verhindern.
Und erwarten wir, wie auch hier in der Kunstwelt nicht, dass wir da draußen nicht auch ‘Fremde’ sein und uns von Zeit zu Zeit von politischen Unkorrektheiten derer beschmutzt und befremdet fühlen werden, die auch Teil dieser planetaren Gemeinschaft sind und mit uns die anstrengende Arbeit der Vorstellung und Bildung von neuen Gemeinschaften von ‘Wiren’ verrichten. Mehr, aber auch weniger als das, kann man von einer Kunst und Künstler*innen, die sich als autonom, frei, als »fünfte Macht im Staate« (Philipp Ruch) verstehen, nicht verlangen. Das Beruhigende ist: In diesem schwierigen Auftrag sind wir zusammen.
Es war letztes Jahr der schwule französische Schriftsteller Edouard Louis, der in einer Lesung in Köln daran erinnerte, dass er während seines Studienaufenthalts in den USA gelernt habe, wie wichtig die Entscheidung sei, für wen, mit wem und wofür wir Kunst machen, damit sie wirklich und nicht nur in Gedanken politisch ist. In den USA hätte er häufiger von Afroamerikaner*innen mit Stolz in der Stimme gehört, die die Bücher der wundervollen Schwarzen Schriftstellerin Toni Morrison selbst nicht gelesen hätten, dass Toni Morrison, die leider auch kürzlich von uns gegangen ist, ja ‘für sie’, für die afroamerikanische Community geschrieben habe.
Es war diese Toni Morrison, die einen Ratschlag an uns alle und vor allem die Jungen unter euch hatte, die versuchen, mit der Kunst die Welt zu verändern:
»I tell my students, 'When you get these jobs that you have been so brilliantly trained for, just remember that your real job is that if you are free, you need to free somebody else. If you have some power, then your job is to empower somebody else. This is not just a grab-bag candy game.’«
— Toni Morrison
Zum Schluss eine letzte Bemerkung: Verstehen Sie meine Worte bitte als einen Versuch, mich und jene, die von da draußen in, aus und mit mir sprechen, in diesen Kunstraum zu stellen und nicht – wie mir häufig selbst schon geschehen – nur eingeschüchtert von dem Glanz der weißen Wände laut zu schweigen oder leise zu sprechen. Fühlen Sie sich dazu eingeladen, mit mir, untereinander und mit den künstlerischen Arbeiten in dieser Ausstellung ins Gespräch zu kommen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen guten Abend und uns allen: Mut für alles Kommende, Trauer und Wut über alles Vergehende, die Gegenwart von guten Freund*innen, die sich – was immer auch in Zukunft geschehe – im Zweifel schützend vor uns stellen werden, die kollektive Fähigkeit, den Zufall und das Glück zu kreieren, und nicht zuletzt das vollendete Recht auf ein hoffnungsvolles Leben!